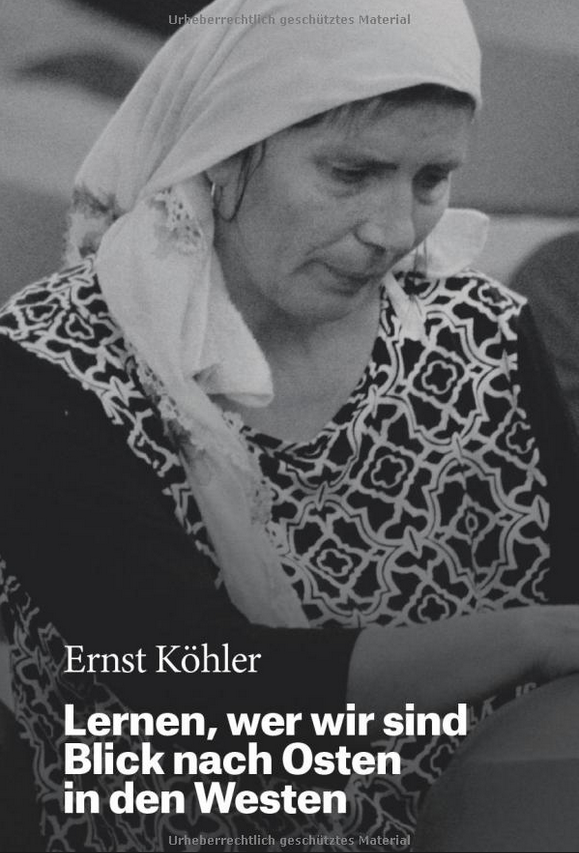Zur Aktualität der politischen Denkerin Hannah Arendt*
* Vortrag im Theater am Mühlenrain, Weil am Rhein, am 13. März 2005.
In der polaren Verklammerung von Totalitarismus und Demokratieentwurf kann man, so unser Autor, eine zentrale Denkfigur von Hannah Arendt beobachten. Arendt fragte auch im Falle des Nationalsozialismus nach der persönlichen Verantwortung – nicht nur derer da oben, sondern auch jener da unten. Sie setzte sich mit der Figur des »Spießers« auseinander, mit dem infizierten Denken, mit der auffallenden Gefühllosigkeit der deutschen Nachkriegsgesellschaft, aber auch mit der Bewährung des Individuums unterhalb glorifizierter Heldenschaft. Hannah Arendt warnte später aus guten Gründen vor totalisierenden Tendenzen in den repräsentativen Demokratien und betonte die Herausforderung der Demokratisierung der Demokratie. In ihrem tastenden, experimentellen Denken war kein Platz für Patentrezepte. Aus der Freiheit des Handelns wollte sie niemanden entlassen.
In seinem Tagebuch eines Demonstranten schreibt der auch bei uns nicht unbekannte ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowytsch über die dramatischen Tage nach dem 21. November in Kiew: »Es ist wie bei einem Pendel: Die Stimmung schwankt zwischen Euphorie und Depression. Zu langer Aufenthalt in der Redaktion von Krytyka fördert Unsicherheit und Zweifel. Wir reflektieren und kritisieren, werden von Enttäuschung überwältigt, von Skepsis, Ironie, bestärken uns gegenseitig in unserer Verzweiflung. In solchen Momenten muss man auf den Majdan gehen. Das ist die beste Therapie gegen Unglauben und Müdigkeit. Ohne den Majdan kann ich nicht mehr leben; keine Nacht, in der ich nicht von ihm träume. Das Wort ›wir‹ nimmt auf dem Majdan eine völlig neue, überraschende Bedeutung an.« (NZZ, 9.12.04)
Zweifellos eine schöne kleine Geschichte. Was das mit Hannah Arendt zu tun hat? Bei Hannah Arendt geht es genau um solche Geschichten. Um eben diesen spontanen Schritt zu den anderen hin – aus der Absonderung, wie erlesen auch immer, in den gemeinsam erschlossenen und gemeinsam gehaltenen Raum des politischen Handelns, wie neu und ungewohnt auch immer. Im demokratischen Momentum von Kiew scheint er für einmal leicht zu fallen. Aber er ist unersetzlich. Und er lässt sich niemals delegieren. Man muss den Schritt immer persönlich machen. Das ist für Hannah Arendt das handfeste, praktische, physische Kriterium für politische Freiheit. Wo die Menschen den Schritt unterlassen – und sei es nur, weil sie ihn unter den Bedingungen einer gut geölten Parteiendemokratie für unnötig oder ineffizient oder gar illusionär halten, kann man nach Hannah Arendt nicht ernsthaft von politischer Freiheit sprechen.
Hier gleich noch eine von diesen raren kleinen Geschichten, diesmal aber eine von Hannah Arendt selbst. Sie spielt 1946 in Moskau und entsprechend tief oder besser gesagt elementar setzt sie notgedrungen an:
»Ganz anders liegt der Fall Pasternak. Er ist einzigartig, denn in ihm handelt es sich um den einzigen großen Dichter aus der frühen Revolutionsperiode, der wie durch ein Wunder nicht vernichtet wurde und der, weil er die ungeheure Kraft hatte, Jahrzehnte zu schweigen, in seiner dichterischen Substanz nicht zerstört worden ist. Für die Hoffnung, dass ›Orwells 1984 nur ein Albtraum ist‹, ist er die einzige lebendige und herrliche Stütze. Aber in den Bereich dieser Hoffnungen gehört auch die außerordentliche Anekdote, die von dem offenbar einzigen öffentlichen Auftreten des Dichters unter der totalen Herrschaft berichtet wird. Pasternak, so hören wir, hatte in Moskau einen Vorleseabend angekündigt, zu dem sich eine ungeheure Menschenmenge eingefunden hatte, wiewohl doch sein Name nach all den Jahren des Schweigens nur noch als der des Übersetzers von Shakespeare und Goethe ins Russische bekannt war. Er las aus seinen Gedichten, und es geschah, dass ihm beim Lesen eines alten Gedichtes das Blatt aus der Hand glitt: ›Da begann eine Stimme im Saal aus dem Gedächtnis das Gedicht weiterzusprechen. Von mehreren Ecken des Saales stiegen andere Stimmen auf. Und im Chor endete die Rezitation des unterbrochenen Gedichts.‹ …«(1)
Bevor wir uns ihrem Verständnis von diesem »Wir«, diesem öffentlichen »Zusammenhandeln« zuwenden und der politischen Macht, die dabei entstehen kann, sollten wir uns den dunklen Erfahrungshintergrund vergegenwärtigen, vor den oder gegen den Hannah Arendt ihre Vorstellung von Spontaneität, von politischem Handeln und schließlich auch von Republik stellt. Unübersehbar ist ja das Gegeneinander oder besser die polare Verklammerung von Totalitarismusanalyse und Demokratieentwurf in diesen Texten. Es handelt sich um die eigentliche Inspirationsquelle dieses Denkens. Und wir werden noch sehen, dass ein Zwei-Phasen-Schema – zuerst, Ende der Vierzigerjahre, die Arbeit am Totalitarismusbuch, dann in den späten Fünfziger- und frühen Sechzigerjahren, die Entdeckung der Freiheit – ihm nicht gerecht würde. Ich spreche hier ungeniert von Totalitarismus, dabei werde ich mich im Folgenden – schon aus schlichten Kompetenzgründen – auf das NS-Regime beschränken oder auf das, was Hannah Arendt darüber zu sagen hat. Und hier auch nur auf ein Problem, das mir immer noch als besonders irritierend erscheint, als quälend ungelöst – auch nach Hannah Arendt noch, die darüber mehr und furchtloser nachgedacht hat als andere Autoren, die ich kenne: nämlich die Frage der persönlichen Verantwortung in solchen politischen Verhältnissen.
Das wäre also meine Gliederung – erster Punkt:
Wie sieht Hannah Arendt jene unzähligen Menschen, die in einem Unrechtssystem wie dem nationalsozialistischen im Prinzip tun, was man von ihnen verlangt? Oder sogar noch mehr, als man ihnen abverlangt? Und wie bewertet oder gewichtet sie die persönliche Verantwortung dieser Leute?
Zweiter Punkt: Wie steht es um die Gegenkräfte? Welche Aussichten für das freie, aber nicht unorganisierte Eingreifen von unten oder von außen jenseits der etablierten Entscheidungsmechanismen kann Hannah Arendt dann in der Demokratie westlichen Typs selber ausmachen? Der Durchbruch zur Demokratie dauert nicht ewig. Auch wenn er tatsächlich gelingt, nicht. Die hinreißenden Szenen in Kiew sind vorbei. Was bleibt nachher davon noch übrig? Müssen solche hohen Zeiten der demokratischen Massenpolitisierung nicht Episode bleiben?
Beide Male geht es also nicht in erster Linie um die Eliten, auch nicht um die Intellektuellen, sondern um die namenlose Masse – einmal der kleinen und mittleren Funktionsträger, ohne die das NS-Regime seine Ziele nicht erreicht hätte; dann der einfachen Bürger, die in aller Regel auch in der liberalen, rechtsstaatlich verfassten Demokratie nur »repräsentiert« werden, statt höchstpersönlich in der Politik präsent zu sein. Nur dass diese Menschen bei Hannah Arendt nicht als die sprichwörtliche »breite Masse« figurieren und sich mit ein paar fragwürdigen, hochmütigen Klischees abgetan sehen – die gleichgeschalteten Untertanen Hitler-Deutschlands nicht, und die schleichend oder kalt entmachteten Bürger Amerikas schon gar nicht.
1.
Zu den bekanntesten und wirklich gelesenen Texten Hannah Arendts gehört zweifellos »Besuch in Deutschland« aus dem Jahre 1950.(2) Im Auftrag der Commission on European Jewish Cultural Reconstruction reist Hannah Arendt von August 1949 bis März 1950 durch Deutschland, und es ist ein bitteres und böses Wiedersehen:
»Das einfachste Experiment besteht darin, expressis verbis festzustellen, was der Gesprächspartner schon von Beginn der Unterhaltung an bemerkt hat, nämlich dass man Jude sei. Hierauf folgt in der Regel eine kurze Verlegenheitspause; und danach kommt – keine persönliche Frage, wie etwa: ›Wohin gingen Sie, als Sie Deutschland verließen?‹, kein Anzeichen für Mitleid, etwa dergestalt: ›Was geschah mit Ihrer Familie?‹, sondern es folgt eine Flut von Geschichten, wie die Deutschen gelitten hätten (was sicher stimmt, aber nicht hierher gehört); und wenn die Versuchsperson dieses kleinen Experiments zufällig gebildet und intelligent ist, dann geht sie dazu über, die Leiden der Deutschen gegen die Leiden der anderen aufzurechnen, womit sie stillschweigend zu verstehen gibt, dass die Leidensbilanz ausgeglichen ist …«
Wie frisch sich das heute liest! Oder heute wieder. Nur die kurze Verlegenheitspause wirkt nicht mehr ganz so aktuell. Die »Unfähigkeit zu trauern« gehört an sich zum eisernen Bestand bundesdeutscher Erinnerungsarbeit – gegenwärtig scheint man dem altbewährten Topos publizistisch und in den Massenmedien sogar ganz ungeahnte neue Möglichkeiten abgewinnen zu wollen. Aber ich wüsste nicht zu sagen, wo die Verweigerung des Denkens hinter dem Trauerdefizit so klarsichtig aufgezeigt worden wäre wie in dieser kleinen Gelegenheitsarbeit. Die auffallende Gefühllosigkeit in Nachkriegsdeutschland ist schlimm, aber sie ist noch nicht das Schlimmste:
»Der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt jedoch in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen. Beispielsweise kommt als Antwort auf die Frage, wer den Krieg begonnen habe – ein keineswegs heiß umstrittenes Thema –, eine überraschende Vielfalt von Meinungen zu Tage. In Süddeutschland erzählt mir eine Frau von ansonsten durchschnittlicher Intelligenz, die Russen hätten mit einem Angriff auf Danzig den Krieg begonnen – das ist nur das gröbste von vielen Beispielen. Doch die Verwandlung von Tatsachen in Meinungen ist nicht allein auf die Kriegsfrage beschränkt; auf allen Gebieten gibt es unter dem Vorwand, dass jeder das Recht auf eine eigene Meinung habe, eine Art Gentlemen’s Agreement, dem zufolge jeder das Recht auf Unwissenheit besitzt – und dahinter verbirgt sich die stillschweigende Annahme, dass es auf Tatsachen nun wirklich nicht ankommt. Dies ist in der Tat ein ernstes Problem, … weil der Durchschnittsdeutsche ganz ernsthaft glaubt, dieser allgemeine Wettstreit, dieser nihilistische Relativismus gegenüber Tatsachen sei das Wesen der Demokratie. Tatsächlich handelt es sich dabei natürlich um eine Hinterlassenschaft des Naziregimes.«
Das Denken selbst scheint infiziert – oder wenn das zu weit geht, doch die Denkbereitschaft. Eine gewisse Unsicherheit empfindet man freilich schon beim Wiederlesen dieser Sätze. Vielleicht sollte man es besser offen lassen, wie weit diese Leute den Dummen nur spielen. Sonst macht man noch eine Art Opfer aus ihnen. Es könnte ja sein, dass wir es hier nicht mit Verwirrung zu tun haben, sondern mit Unverschämtheit. Wie dem auch sei: Die Standards, die Kriterien für eine vernünftige Aussage haben jedenfalls im damaligen Deutschland offenkundig ihre Verbindlichkeit eingebüßt. Jeder kann sich ungestraft erlauben, sie einfach zu missachten. Die doktrinären Inhalte, die Ideologien der NS-Zeit haben sich längst verflüchtigt – unerwartet spurlos sogar. Es bleibt nur die opportune Verwahrlosung des Denkens, die sorgsam antrainierte Willkür:
»Die Nazis haben das Bewusstsein der Deutschen vor allem dadurch geprägt, dass sie es darauf getrimmt haben, die Realität nicht mehr als Gesamtsumme harter, unausweichlicher Fakten wahrzunehmen, sondern als Konglomerat ständig wechselnder Ereignisse und Parolen, wobei heute wahr sein kann, was morgen schon falsch ist.«
Wir werden dieser alarmierten Aufmerksamkeit für das Denken, für das Urteilen und für das politische Schindluder, das mit dieser menschlichen Möglichkeit getrieben wird, wieder begegnen – sie zieht sich durch das gesamte Werk Hannah Arendts.
Einen Lichtblick gibt es: In Berlin glaubt Hannah Arendt, ein anderes politisches Klima anzutreffen. Und andere Leute – sie schreibt darüber ganz glücklich, geradezu überschwänglich an ihren Mann Heinrich Blücher:
»Aber: Was es noch gibt, sind die Berliner. Unverändert, großartig, menschlich, humorvoll, klug, blitzklug sogar. Dies zum ersten Mal wie nach Hause kommen … durch die Trümmer fahrend: Mein Chauffeur, 20-jähriger Junge, hübsch und nett: Die Ostzone können Sie gleich erkennen; da hängt so viel Quatsch rum (er meint Fahnen und Plakate). Wir kommen an einem Stalin-Plakat vorbei: Stalin, der große Freund des Volkes. Darauf er: Tja, wir haben bereits so ’nen großen Freund des Volkes gehabt; und das hat er denn seinem geliebten Volk hinterlassen (auf die Trümmer weisend). (Dazu musst Du wissen, dass niemand, aber positiv niemand in ganz Deutschland je die Trümmer mit Hitler in Beziehung bringt.) …«(3)
Ein zweiter berühmter Text: »Organisierte Schuld«, 1944 in Amerika verfasst, 1945 in englischer, 1946 in deutscher Sprache veröffentlicht.(4) Er führt uns von Nachkriegsdeutschland in die NS-Zeit selbst zurück:
»Die ungeheure Erregung, in die nachgerade jeder Mensch guten Willens gerät, wenn die Rede auf Deutschland kommt, … ist erzeugt von jener ungeheuerlichen Maschine des ›Verwaltungsmassenmordes‹, zu deren Bedienung man nicht Tausende und nicht Zehntausende ausgesuchter Mörder, sondern ein ganzes Volk gebraucht hat und gebrauchen konnte. … Dass in dieser Mordmaschine jeder auf diese oder jene Weise an seinen Platz gezwungen ist, auch wenn er nicht direkt in den Vernichtungslagern tätig ist, macht das Grauen aus. … Wie an dem ›Verwaltungsmassenmord‹ der politische Verstand des Menschen stillsteht, so wird an der totalen Mobilisierung für ihn das menschliche Bedürfnis nach Gerechtigkeit zuschanden. Wo alle schuldig sind, kann im Grunde niemand mehr urteilen. Denn dieser Schuld gerade ist auch der bloße Schein, die bloße Heuchelei der Verantwortung genommen. Solange die Strafe das Recht des Verbrechers ist – und auf diesem Satz beruht seit mehr als zweitausend Jahren das Gerechtigkeits- und das Rechtsempfinden der abendländischen Menschheit, gehört zum Strafen eine Überzeugung von der Verantwortungsfähigkeit des Menschen.«
Wie man sieht, kündigt sich hier bereits die Problemstellung des späteren Buches Eichmann in Jerusalem an. Der Prozess kann freilich nur einer bestimmten verantwortlichen und schuldfähigen Person gemacht werden – diese Vorentscheidung und die Klarheit, die sie bringt, wird die Reporterin Hannah Arendt in Jerusalem als Wohltat, als Befreiung empfinden. Und man begreift bei der Lektüre des frühen Textes auch, warum. Merkwürdigerweise überspringen die werkgeschichtlichen Verbindungslinien das monumentale Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, das ja an sich oder rein chronologisch betrachtet dazwischenliegt. Der Holocaust ist dort gar nicht das Thema. Das Kapitel über die »Konzentrationslager« geht an den Vernichtungslagern im Osten vorbei. Und die »Massen«, wie sie hier genannt werden, folgen Hitler und seiner Politik dort so widerstandslos, weil sie sozial entwurzelt und politisch ohne Orientierung sind. Und zuallererst einmal einen neuen festen Halt in einer chaotischen und unverständlich gewordenen Welt suchen. Letztlich sind es Verzweifelte, Verlassene, geistig Obdachlose, die sich da dem Führungsanspruch des Nationalsozialismus überantworten. Man fühlt sich hier an einige Meisterwerke der Weimarer Soziologie erinnert – an Die Angestellten (1929) von Siegfried Kracauer etwa oder an die Aufsätze Emil Lederers über die neuen Mittelschichten (1929) oder an Die soziale Schichtung des deutschen Volkes (1932) von Theodor Geiger und das darin gezeichnete Bild von den Erwerbslosen. 1944 schlägt Hannah Arendt einen ganz anderen Ton an: Es ist hier der »Spießer«, der Typus des treu sorgenden Familienvaters, der die Vernichtungsapparatur am Laufen hält. »Seine Gefügigkeit war in den Gleichschaltungen zu Beginn des Regimes bereits bewiesen worden. Es hatte sich herausgestellt, dass er durchaus bereit war, um der Pension, der Lebensversicherung, der gesicherten Existenz von Frau und Kindern willen Gesinnung, Ehre und menschliche Würde preiszugeben. … Die einzige Bedingung, die er von sich aus stellte, ist, dass man ihn von der Verantwortung für seine Taten radikal freisprach. Es ist der gleiche Durchschnittsdeutsche, den die Nazis trotz wahnsinnigster Propaganda durch Jahre hindurch nicht dazu haben bringen können, einen Juden auf eigene Faust totzuschlagen (selbst nicht, als sie es ganz klar machten, dass solch ein Mord straffrei ausgehen würde), der heute widerspruchslos die Vernichtungsmaschinen bedient.« Es handelt sich für Hannah Arendt auch keineswegs um ein spezifisch deutsches Phänomen. In Deutschland konnte es nur besonders gut gedeihen: »Kaum ein anderes der abendländischen Kulturländer ist von den klassischen Tugenden des öffentlichen Lebens so unberührt geblieben; in keinem haben privates Leben und private Existenz eine so große Rolle gespielt. … Der Spießer selbst aber ist eine internationale Erscheinung, und wir täten gut daran, ihn nicht im blinden Vertrauen, dass nur der deutsche Spießer solch furchtbarer Taten fähig ist, allzu sehr in Versuchung zu führen. Der Spießer ist der moderne Massenmensch, betrachtet nicht in den exaltierten Augenblicken in der Masse, sondern im sicheren oder vielmehr heute so unsicheren Schutz seiner vier Wände. Er hat die Zweiteilung von Privat und Öffentlich, von Beruf und Familie so weit getrieben, dass er noch nicht einmal in seiner eigenen identischen Person eine Verbindung zwischen beiden entdecken kann. Wenn sein Beruf ihn zwingt, Menschen zu morden, so hält er sich nicht für einen Mörder, gerade weil er es nicht aus Neigung, sondern beruflich getan hat. Aus Leidenschaft würde er nicht einer Fliege etwas zu Leide tun. Wenn man einem Individuum dieser neuesten Berufsgattung, die unsere Zeit hervorgebracht hat, morgen sagen wird, dass er zur Verantwortung gezogen wird, so wird er sich nur betrogen fühlen.«
Ich wiederhole: Wir schreiben das Jahr 1944! Ich glaube nicht, dass Hannah Arendt irgendwo jemals weiter gegangen ist im Bemühen zu verstehen als in diesem Text und in diesen Sätzen. Man kann sich vor diesem intellektuellen Mut nur verneigen. Er liegt darin, dass die Verfolgte sich hier den Boden für eine Anklage, für eine Abrechnung selber zu entziehen droht.
Ich versuche, zwei Fragen zu formulieren. Kann man überhaupt akzeptieren, was Hannah Arendt hier sagt? Kann ein Erwachsener unter der NS-Herrschaft – ein Mensch, der also vor 1933 aufgewachsen ist – sich überhaupt dermaßen perfekt und durchschlagend selber entlasten, von aller Verantwortung freisprechen und gegen jedes Schuldbewusstsein immunisieren? Primo Levi hat in Die Untergegangenen und die Geretteten für den Fall Eichmann und ähnlicher Verbrecher daran erinnert, dass das »Dritte Reich« schließlich nur zwölf Jahre gedauert hat. Kann ein totalitäres Regime in einem so kurzem Zeitraum, der im letzten Drittel auch noch eine Phase des Untergangs war, das Rechtsempfinden und Verantwortungsgefühl eines Menschen tatsächlich auslöschen? Schon die klassische Studie des Strafrechtlers Herbert Jäger über Verbrechen unter totalitärer Herrschaft (1967) lässt Zweifel an der starren, hermetischen Figur des arendtschen Spießers aufkommen. Oder an ihrer Repräsentativität – allgemein gesprochen macht diese Arbeit die Gebrochenheit oder Reflexivität der deutschen Täter stärker. Etwa indem sie die Angst in Anschlag bringt, die sich spätestens nach Stalingrad unter den Deutschen ausbreitet – mit der Angst vor der sich abzeichnenden Niederlage und ihren Folgen meldet sich auch das Gewissen zurück. Anscheinend war es eher storniert, wenn man so sagen darf, als tot. Und Hans Buchheim nimmt in seinem Gutachten für den Auschwitzprozess von 1964 sogar für die Masse der SS-Angehörigen eher ein Nebeneinander von traditionellem Rechtsempfinden und rassistischer Hybris an.(5) Inzwischen ist natürlich viel geforscht und nachgedacht worden, man denke nur an die Hamburger Wehrmachtsaustellung – aber die Masse der kleinen Täter, der »ganz normalen Männer«, um die zu Recht berühmte Pionierstudie von Christopher Browning zu zitieren, bleibt schon aus Mangel an Quellen im Dunkeln für uns.
Die andere Frage wäre: Was macht die rechtsstaatlich verfasste Demokratie mit diesen Menschen, wenn alles vorbei ist? Es ist die Frage, mit der Hannah Arendt dann in Eichmann in Jerusalem ringen wird.(6) Ich spreche von einem Ringen, obwohl es der Berichterstatterin aus Amerika ganz fern liegt, dem Angeklagten vor dem israelischen Bezirksgericht seine lächerliche Ausflucht vom »kleinen Rädchen« abzunehmen. Aber sie ist bereit, Eichmann in den konkreten politischen Kontext zu stellen, in dem er seinerzeit gehandelt hat. Und wiederum, wie schon zwei Jahrzehnte früher, wagt sie es, die Frage aufzuwerfen, wie denn ein Mensch sich des verbrecherischen Charakters seines Tun bewusst werden soll, wenn der Rechtsbruch in einem politischen System das Normale ist und nicht das Recht. Wenn das Verbrechen vom Staat, vom Machtzentrum gewollt und angeordnet ist. Wenn das Verbrechen selber Recht wird und sich in der Form von amtlichen und der Form nach rechtmäßigen Verordnungen immer tiefer in die Rechtsordnung hineinfrisst. Vielleicht kann Hannah Arendt es wagen, diese verstörende Frage aufzuwerfen, weil die Richter Eichmanns es nicht tun. Sie erinnern sich: Hannah Arendt bewundert diese Richter, sie vertraut ihnen, sie verehrt sie geradezu – wegen ihrer Ruhe, ihrer Geistesgegenwart und ihrer Fairness dem Angeklagten gegenüber. Aber vor allem, weil diese drei Männer überhaupt ein ordentliches, reguläres Gerichtsverfahren durchzuführen versuchen – gegen die rechtsfremden politischen Absichten des Anklägers (und des hinter ihm stehenden David Ben Gurion) mit diesem Prozess. Die andere Seite dieser Professionalität und Kultiviertheit ist freilich die althergebrachte Überzeugung, dass jeder Mensch im Innersten weiß, was Mord ist. Und zu erkennen vermag, was ein verbrecherischer Befehl ist. Jeder Mensch trägt ein untrügliches, letztlich unzerstörbares Sensorium oder Unterscheidungsvermögen für Recht und Unrecht in sich – das glauben die Richter. Hannah Arendt glaubt es nicht, sie widerspricht dieser konventionellen Sicht. Aber sie sieht auch, dass die Richter ihren Job nur mit Hilfe dieses altmodischen Menschenbildes zu Ende bringen können. Und sie ist ganz einverstanden damit, sie ist den Richtern dankbar dafür, dass sie ihn mit Würde und Anstand zu Ende bringen.
Aber dann scheint Hannah Arendt den gordischen Knoten dieses Gerichtsverfahrens auf einmal durchschlagen zu wollen. Am Ende des »Epilogs«, der sich mit der Perspektive einer künftigen internationalen Strafjustiz befasst, rückt sie unvermittelt mit einer alternativen Urteilsbegründung heraus. Die Richter hätten dem Verurteilten sagen können: »Denn wenn Sie sich auf Gehorsam berufen, so möchten wir Ihnen vorhalten, dass die Politik ja nicht in der Kinderstube vor sich geht und dass im politischen Bereich der Erwachsenen das Wort Gehorsam nur ein anderes Wort für Zustimmung und Unterstützung ist. So bleibt also nur übrig, dass Sie eine Politik gefördert und mitverwirklicht haben, in der sich der Wille kundtat, die Erde nicht mit dem jüdischen Volk und einer Reihe anderer Volksgruppen zu teilen …« Das ist bestechend. Jeder ist für seinen Gehorsam selbst verantwortlich. Aber es hat auch etwas von einem Befreiungsschlag. In einem anderen Text aus der gleichen Zeit erläutert Hannah Arendt ihre provozierende These: »Wenn wir das Wort ›Gehorsam‹ für all diese Situationen gebrauchen, dann geht dieser Gebrauch auf die uralte politikwissenschaftliche Vorstellung zurück, die uns – seit Plato und Aristoteles – sagt, dass jedes politische Gemeinwesen aus Herrschern und Beherrschten besteht und dass Erstere befehlen und Letztere gehorchen … ich möchte doch betonen, dass sie frühere, und ich glaube auch genauere Auffassungen von den Beziehungen zwischen den Menschen in der Sphäre gemeinsamen Handelns ersetzten. Diesen früheren Auffassungen zufolge kann jede Handlung, die von einer Mehrzahl von Menschen ausgeführt wird, in zwei Phasen eingeteilt werden: den Anfang, den ein ›Führer‹ macht. und die Ausführung, an der sich viele beteiligen, um etwas, was dann ein gemeinsames Unternehmen wird, mit Erfolg abzuschließen.«(7) Kooperation statt Befehlskette – Hannah Arendt muss ihre ganze Kritik an den »fragwürdigen Traditionsbeständen« aufbieten – einen Begriff von Politik, wie sie ihn etwa Ende der Fünfzigerjahre in der unvollendet gebliebenen »Einführung in die Politik« entworfen hatte, um zu einer klaren Position gegenüber Eichmann und seiner persönlichen Schuld zu finden.(8) Der Prozess ist mit seiner Tendenz zum »Schauprozess«, wie auch Hannah Arendt es nennt, schon problematisch genug. Aber das Kernproblem ist doch für sie ein Angeklagter, ein Täter, der »nicht denken« kann. Jahre später wird sie sich diese Wahrnehmung noch einmal vergegenwärtigen: »Wie monströs die Taten auch immer waren, der Täter war weder monströs noch dämonisch, und das einzige unverkennbare Kennzeichen, das man in seiner Vergangenheit ebenso wie in seinem Verhalten während des Prozesses und der vorausgehenden polizeilichen Untersuchung entdecken konnte, war etwas vollkommen Negatives: nicht Dummheit, sondern eine merkwürdige, durchaus authentische Unfähigkeit zu denken. In der Rolle des prominenten Kriegsverbrechers funktionierte er ebenso wie zuvor unter dem Nazi-Regime; es bereitete ihm nicht die geringste Schwierigkeit, völlig andere Regeln zu akzeptieren. Er wusste, dass das, was er einst als seine Pflicht angesehen hatte, nun als Verbrechen bezeichnet wurde, und er akzeptierte diesen neuen Kodex der Beurteilung, als handele es sich um nichts anderes als um eine andere Sprachregel … Klischees, gängige Redewendungen, das Festhalten an konventionellen, standardisierten Kodizes des Ausdrucks und Betragens haben die gesellschaftlich anerkannte Funktion, uns vor der Wirklichkeit in Schutz zu nehmen, das heißt vor dem Anspruch, den alle Ereignisse und Tatsachen kraft ihrer Existenz an unsere denkende Aufmerksamkeit stellen. Wenn wir für diesen Anspruch jederzeit empfänglich wären, wären wir bald erschöpft; der Unterschied bei Eichmann war lediglich, dass er eindeutig solchen Anspruch überhaupt nicht kannte.«(9)
An dieser Stelle vielleicht eine erste Zwischenbilanz: Man muss sich vorsehen bei Hannah Arendt. Ihre Texte sind oft faszinierend formuliert und geradezu überwältigend scharfsinnig. Man sieht sich jedes Mal überzeugt. Erst hinterher kratzt man mühsam seine Zweifel und Einwände zusammen. Und erst langsam begreift man auch, dass man hier ein tastendes, ein experimentelles Denken vor sich hat. Konsistenz ist nicht unbedingt sein Maßstab und Ziel. Es geht um Verstehen – in immer neuen Anläufen. Allein in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft lassen sich schon drei davon unterscheiden.(10) Und »Organisierte Schuld« und Eichmann in Jerusalem enthalten wiederum einen anderen Denkansatz. Diese beiden Texte nehmen dem typischen subalternen Hitler-Anhänger gewissermaßen die Tragik weg. Sie machen ihn kleiner, hässlicher, banaler. Aber eines scheint allen Varianten von Verfügbarkeit, wie Hannah Arendt sie nacheinander entwickelt, gemeinsam: Die Hauptsache für sie alle ist immer, dass überhaupt eine Ordnung, ein System, eine Richtung da ist, ganz egal was für eine.
Für mich ist das immer noch ein wesentlicher Beitrag zum Verständnis des NS-Regimes. Man muss sich freilich klar machen, auf welcher Macht-Ebene man sich hier befindet. Inzwischen sind ganz andere und bedeutend höherrangige Tätertypen in den Fokus der historischen Forschung und auch der interessierten Öffentlichkeit gerückt – Leistungsträger, hochkompetent, kreativ, entsetzlich inspiriert wie die wissenschaftlichen »Vordenker der Vernichtung«, um die bahnbrechende Studie von Götz Aly und Susanne Heim zu nennen. Oder wie Werner Best, für den, wie Ulrich Herbert in einer großen Monographie nachgewiesen hat, die Vernichtung der Juden ein rationales und nichts als ein rationales Gebot völkischer Überlebensstrategie war. Dort findet sich auch eine knappe, kühle Relativierung von Eichmann in Jerusalem und der Debatte, die das Buch zumindest in den Sechzigerjahren ausgelöst hat:
»Dass sich Eichmann … als organisationswütiger Spießer ohne jedes persönliche und intellektuelle Format entpuppte, musste auf die Überlebenden und die Nachkommen der Opfer wie ein Hohn wirken. Aber Eichmann spielte ebenso wie die in Frankfurt angeklagten Aufseher des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz in der Hierarchie des RSHA nur eine untergeordnete Rolle, und für die Führer des Terrorapparates war er eher untypisch. So hat es sich historiographisch möglicherweise verhängnisvoll ausgewirkt, dass von nun an der nationalsozialistische ›Schreibtischtäter‹ in den Kategorien des beflissenen Befehlsempfängers Eichmann betrachtet wurde.«(11)
2.
Aber jetzt auf die helle Seite! Sie hat auch in den dunkelsten Zeiten nicht ganz gefehlt. Man erinnere sich nur an das Denkmal, das Hannah Arendt in Eichmann in Jerusalem dem öffentlichen Widerstand der Dänen gegen die Deportation der dänischen Juden gesetzt hat: »Die Geschichte der dänischen Juden ist sui generis; im Kreise der Länder Europas – ob besetzt oder neutral und wirklich unabhängig – war das Verhalten des dänischen Volkes und seiner Regierung einzigartig. Diese Geschichte möchte man als Pflichtlektüre aller Studenten der politischen Wissenschaft empfehlen, die etwas darüber erfahren wollen, welch ungeheure Macht in gewaltloser Aktion und im Widerstand gegen einen an Gewaltmitteln vielfach überlegenen Gegner liegt.« Faktisch lässt sich das so kaum halten. Die Geschichtswissenschaft hat reichlich Wasser in diesen Wein gegossen.(12) Aber es bleibt immer noch genug: Die Nazis sind hier glatt gescheitert. Anders als in Frankreich hat auch die Polizei nicht kollaboriert. Die Juden, etwa 8000 Leute, sind mit kleinen Booten über den Sund nach Schweden gebracht worden. Wir verdanken dieser Autorin Herrschaftsanalysen von einer geradezu erschütternden Schonungslosigkeit. Aber Widerstand hat sie niemals unterschlagen oder herabgesetzt. Wo sie auf ihn trifft, würdigt sie ihn. Und wie sie ihn würdigt: Im Jerusalemer Prozess berichtet ein Zeuge, ein ehemaliger jüdischer Untergrundkämpfer, von einem deutschen Feldwebel, der ihnen geholfen hatte und dafür hingerichtet worden war: »Während der wenigen Minuten, die Kovner brauchte …, lag Stille über dem Gerichtssaal; es war, als habe die Menge spontan beschlossen, die üblichen zwei Minuten des Schweigens zu Ehren des Mannes Anton Schmidt einzuhalten. Und in diesen zwei Minuten, die wie ein plötzlicher Lichtstrahl inmitten dichter, undurchdringlicher Finsternis waren, zeichnete ein einziger Gedanke sich ab, klar, unwiderlegbar, unbezweifelbar: Wie vollkommen anders alles heute wäre, in diesem Gerichtssaal, in Israel, in Deutschland, in ganz Europa, vielleicht in allen Ländern der Welt, wenn es mehr solcher Geschichten zu erzählen gäbe.« Zwei Seiten weiter heißt es lakonisch: »Denn die Lehre solcher Geschichten ist einfach, ein jeder kann sie verstehen. Sie lautet, politisch gesprochen, dass unter den Bedingungen des Terrors die meisten Leute sich fügen, einige aber nicht.«
Wer Letztere sind und wie sie es fertig bringen, nein zu sagen, bleibt ein Rätsel. Für Hannah Arendt hat es, wie sollte es anders sein, etwas mit dem Denken zu tun – mit dem Zwiegespräch einer Person mit sich selbst. Hannah Arendt hat diese Hypothese mehrfach vorgetragen – am eindrucksvollsten vielleicht in dem Aufsatz »Über den Zusammenhang von Denken und Moral« aus dem Jahre 1971(13), aber auch in den beiden Sokrates-Kapiteln von »Das Denken«, ursprünglich eine Vorlesung aus dem Jahre 1973, findet sie sich wieder.(14) Das Wichtigste daran ist vielleicht der Verzicht auf Stilisierung. So wie die Mörder für Hannah Arendt keine Monster, so sind die Helden keine Moralgiganten. Es sind einfach nur Leute, die sich im entscheidenden Moment nicht vorstellen können, für den Rest ihres Lebens mit sich selbst als einem Verbrecher zusammenleben zu müssen. Also kein unbeugsames Gewissen. Kein Himmelsgestirn von moralischen Werten. Man muss den Ansatz nicht unbedingt überzeugend finden. Aber verglichen mit dem gewohnten Moralisieren wirkt er wie ein elegantes Understatement. Und jedenfalls erleichtert das eigenartig profane oder minimalistische Gedankenmodell von Widerstand den Zugang zu den unscheinbaren, vorher, bis zum Moment der Bewährung, ganz unauffälligen Helden – etwa, um ein Beispiel aus der Region zu wählen, von der Art eines Paul Grüninger, dem tapferen Polizeikommandanten von St. Gallen. Der ahnte, wie Stefan Keller in seinem schönen Buch nahe legt, vorher wahrscheinlich selber am allerwenigsten, was für einer er eigentlich war. Wenn er überhaupt je einen Gedanken darauf verschwendet hat (Grüningers Fall, Zürich 1993).
Im Dunkeln gibt es das Helle. Und im Hellen gibt es das Dunkle. Untilgbar, unausrottbar – es kann eingedämmt werden, es kann zurückgedrängt werden, aber es kann nicht definitiv überwunden oder gar zum Verschwinden gebracht werden. Die Suche nach tragfähigen, dauerhaften Formen der Freiheit bei Hannah Arendt ist dringlich, beharrlich, unermüdlich. Dem heutigen Leser fällt auf, dass die totalitäre Gefahr für Hannah Arendt noch nicht vorbei ist. Oder sagen wir vorsichtiger: dem deutschen Leser, bei einem amerikanischen bin ich mir da nicht so sicher. Hannah Arendt schließt die Wiederkehr dieser Herrschaftsform niemals ganz aus. Auch nicht für Amerika. In einem Text über die Kommunistenjagd der McCarthy-Ära schreibt sie etwa: »… dass die totalitäre Herrschaft eine neue Staatsform darstellt, die höchstwahrscheinlich als Möglichkeit und immer gegenwärtige Gefahr uns von nun ab in der Geschichte begleiten wird …«(15)
Seit der Wiederveröffentlichung der Beiträge Hannah Arendts für die New Yorker deutsch-jüdische Emigrantenzeitung Aufbau verstehen wir auch die spezifisch jüdische Dimension dieser Unbeirrbarkeit besser.(16) Bis dahin hatte das Buch über Rahel Varnhagen (mit seinen beiden erst Ende der Dreißigerjahre geschriebenen, pointiert assimilationskritischen Schlusskapiteln) gleichsam in der Luft gehangen. Jetzt haben wir das Zwischenstück. In diesen Artikeln der Jahre 1941–1945 formuliert Hannah Arendt zum ersten Mal ihren spezifischen Begriff des politischen Handelns – in doppelter innerjüdischer Frontstellung: gegen die traditionell paternalistische, abwiegelnde, auf eine Entpolitisierung der jüdischen Volksmassen abzielende Politik der jüdischen Eliten und gegen die dominante, gut »realpolitische« Variante des Zionismus, die um jeden Preis den jüdischen Nationalstaat in Palästina durchsetzen will und für sein Überleben ausschließlich auf die Protektion bestimmter Großmächte setzt. Es war das – zum guten Teil freilich imaginäre – Szenarium der um ihre schiere Existenz und darüber hinaus für ihre Gleichrangigkeit unter den Völkern in einer künftigen Weltordnung kämpfenden Juden – als reguläre Soldaten im Krieg gegen das NS-Regime; als Partisanen im Kampf gegen die Besatzungsmacht in Ost- und Westeuropa; als Partner einer Verhandlungslösung mit den Arabern in Palästina –, an dem Hannah Arendt zum ersten Mal durchdacht hat, wie Menschen aus sich selbst verantwortungsbewusste politische Akteure machen könnten. Es ist der jüdische Citoyen, den sie als ersten denkt. Sie besitzt ihn gewissermaßen schon, als sie sich dann an die Interpretation der Gefolgschaft Hitlers macht – in diversen Ausführungen. Und dieser jüdische Citoyen ist auch nicht imaginär. Er ist früher da als der jüdische Staat, und Hannah Arendt wird ihm unmittelbar nach dem Krieg in Amerika leibhaftig begegnen. Ihr Briefwechsel mit Kurt Blumenfeld ist ein schönes Zeugnis dafür.(17)
Aber die Suche nach einem Ort oder Raum für die Freiheit ist auch vergeblich. Die Polis des klassischen Athen ist endgültig versunken. Und es war auch eine Veranstaltung von Sklavenhaltern. Die Gründung der amerikanischen Republik – für Hannah Arendt das andere große weltgeschichtliche Exempel eines politischen Gemeinwesens, das die Freiheit zu institutionalisieren und auf Dauer zu stellen versucht – ist inzwischen zumindest stark versandet. Hannah Arendt wird über Amerika niemals so schreiben, wie sie über das Europa des bequemen Pessimismus, der Nachgiebigkeit oder sogar der Komplizenschaft gegenüber dem Nationalsozialismus an der Macht geschrieben hat. Es gibt immer einen Vorbehalt von Respekt und Vertrauen. Man spürt immer einen Unterton von Loyalität, auch noch in den ganz verzweifelten Texten. Aber Hannah Arendt ist auch hier entschlossen, sich nichts vorzumachen. Der politische Entscheidungsprozess wird auch in den USA von großen Parteimaschinen beherrscht. Und die amerikanische Gesellschaft hat sich schon im 19. Jahrhundert in eine arbeits- und konsumbesessene Massengesellschaft verwandelt, die die alte Bürgertugend weitgehend vergessen und für die politischen Visionen der Founding Fathers kaum mehr Verständnis hat. Das politische Erbe der Amerikanischen Revolution mag noch nicht ganz tot sein, aber es lebt auch nicht mehr richtig. Wie Hannah Arendt in Über die Revolution (1963) aufzuzeigen versucht, lag der Keim des Niedergangs schon darin, dass die basisdemokratischen Einrichtungen der Pionierzeit mit ihren townhall meetings keinen Eingang in die Verfassung gefunden haben. Schließlich wären da noch die Räte, die in bestimmten Krisenmomenten der europäischen Geschichte der letzten hundert Jahre auftauchen: in der Pariser Kommune, am Ende des Ersten Weltkrieges in Russland und Deutschland, in der Ungarischen Revolution von 1956. Hannah Arendt hat den Ereignissen in Ungarn einen Essay gewidmet, der nur auf den ersten Blick unangemessen emphatisch wirkt, in Wahrheit aber gerade die Isoliertheit, die Verlorenheit dieses hoffnungslos verfrühten Freiheitskampfes herausarbeitet. Die Räte kommen für Hannah Arendt aus dem Willen der Massen, die Initiative zurückzugewinnen, die politische Macht zu übernehmen – womit sie zumindest die deutsche Rätebewegung von 1918 gründlich überschätzt oder missversteht. Aber sie gehen regelmäßig ebenso schnell wieder unter, wie sie aufgekommen sind. Nirgends haben sie eine wirkliche Chance gegen die politischen Parteien.
Aber Hannah Arendt bleibt unversöhnt. Es gibt keine Kehrtwendung von der Art, wie die Alt-Achtundsechziger unter uns sie kennen – erst eine hochfliegende »außerparlamentarische« oder gar »anarcholibertäre« Doktrin und dann, nach der Enttäuschung dieser utopischen Hoffnungen, nur noch die Demokratie, so, wie sie ist. Weder das eine noch das andere. Keine Fundamentalopposition, keine Rückkehr in die so genannte politische Mitte. Kein linker Radikalismus, keine Einkehr oder Resignation.
Keine Negation der etablierten demokratischen Institutionen: Hannah Arendt hat das spontane politische Handeln nie als systemsprengend oder grenzenlos emanzipatorisch gedacht, wie nicht wenige von uns es eine Zeit lang getan haben. Sie denkt es immer als eingebettet in ein komplexes Gefüge von republikanischen Institutionen, von politischen »checks and balances«, die es verfeinern, erweitern, zur Mäßigung zwingen. Das heißt: zur Berücksichtigung anderer, abweichender Meinungen – nicht etwa aus Toleranz, sondern weil es, mit dem Gleichnis in Nathan der Weise zu sprechen, den echten Ring gar nicht gibt. Glücklicherweise nicht gibt, wie Hannah Arendt mit Lessing sagt.(18) Freiheit kann es für sie nur im Rahmen eines stabilen Gemeinwesens geben – auch hier spricht, wie Margaret Canovan gezeigt hat, die Erfahrung vom Totalitarismus als reißendem, alles zerstörenden »politischen Hurrikan«.(19) Die Vorstellung von einer ungezügelten, unabgebremsten Mehrheit – und sei es auch einer ganz demokratisch zu Stande gekommenen, die sich selbst absolut setzt und vergötzt –, war Hannah Arendt ein Grauen. Wie vorher auch schon Alexis de Tocqueville, der Mitte der Dreißigerjahre des 19. Jahrunderts in Über die Demokratie in Amerika geschrieben hatte: »… sobald über eine Frage die Mehrheit erst einmal zustande gekommen ist, gibt es sozusagen nichts, was ihren Gang hemmen, geschweige denn zum Stillstand bringen könnte, nichts, was ihr Zeit ließe, die Klagen derer anzuhören, die sie auf ihrem Wege zermalmt.«(20)
Aber eben auch kein Verzicht auf ein grundsätzliches Hinterfragen der etablierten demokratischen Institutionen: Die Bürgerfreiheit – als Freiheit des politischen Handelns, nicht als rechtlich abgesicherte Freiheit von der Politik – bleibt überall ein unerträgliches Desiderat. Der zeitgemäße Platz, die aktuell brauchbare Institution ist für sie noch nirgends gefunden. Als sich im Zeichen des Vietnamkrieges die politischen Verhältnisse in Amerika dann verdüstern und verformen – in »ihrem« Amerika, das sie 1941 aufgenommen hat, dem sie seine Leistung im Zweiten Weltkrieg nie vergisst und das sie in On Revolution vor den Demokratien der Welt ausgezeichnet hatte –, nimmt Hannah Arendt ihre Zuflucht sogar zu einem paradoxen Gedanken. Sie scheint jetzt allen Ernstes für so etwas wie den Einbau des zivilen Ungehorsams in das politische System plädieren zu wollen. Es erscheint ihr in diesem dunklen Moment, der sie am Ende ihres Lebens noch einmal zur leidenschaftlichen politischen Publizistin werden lässt, durchaus nicht abwegig, einen Massenprotest wie den gegen diesen sinnlosen und schändlichen Krieg verfassungsrechtlich legitimieren zu wollen.
Ein nicht zur Ruhe kommendes, nicht zu besänftigendes Problembewusstsein für das strukturelle Freiheitsmanko der repräsentativen Demokratie, so, wie sie ist – eine Beunruhigung, bar aller Rezepte. Ich wüsste nicht, was aktueller wäre. Aber vielleicht hängt mit dieser Unerfülltheit, mit der Absage an das politische Wunschdenken oder, wie man auch sagen könnte, mit der eher defensiven als utopischen Ausrichtung des arendtschen Denkens auch ein einigermaßen esoterisch wirkender Zug zusammen. Ich meine den eigenartigen Hochglanz, den Hannah Arendt dem öffentlichen Handeln durchweg verleiht. Für die Amerikanische Revolution ist von dem unvergleichlichen Glücksgefühl die Rede, das mit dem Auftreten in dieser Sphäre verbunden sei. Mit großer Zustimmung zitiert Hannah Arendt John Adams, für den ausnahmslos alle Menschen sich intensiv danach sehnen, dass »man sie sieht, dass man sie hört, dass man von ihnen spricht, dass man sie anerkennt und respektiert«. In der Polis war es der edle, wenn auch unerbittliche Wettstreit um Auszeichnung, der zumindest die Innenpolitik ausgemacht habe. Immer scheint das politische Handeln bei Hannah Arendt um sich selbst zu kreisen. Und immer scheint die Freiheit ihren Sinn und ihre Erfüllung in sich selber zu finden.
Nein, nicht immer: Die »Überlegungen zu den Pentagon-Papieren« aus dem Jahre 1971 brechen aus diesem Diskurs aus. Das hier gezeichnete Bild von der Führungsmacht der freien Welt – von einer Weltmacht, die nur noch an ihrem »Image« als Weltmacht interessiert scheint – ist allzu bedrohlich. Es verlangt wieder zwingend nach Widerstand, und der kreist nicht um sich selbst.(21) Aber zumindest überall dort, wo es grundsätzlich um die Spezifik des Politischen geht, stoßen wir bei Hannah Arendt auf eine gewisse Tendenz zur Verklärung. Wäre sie ein Surrogat? Die politische Ebene sähe sich dann zu einer autonomen, nahezu in sich geschlossenen Dimension des menschlichen Daseins aufgewertet oder erhöht, weil in der politischen Realität gerade das Entscheidende scheitert: die Demokratisierung der Demokratie. Wie dem auch sei: Der ordinäre Stoff, aus dem für uns und unseren Alltagsverstand die Politik gemacht ist, bleibt jedenfalls außen vor. Der gesellschaftliche Konflikt ist hier etwas Fremdes. Und für den Fall, dass er in die Politik einbricht: etwas Störendes, schlimmstenfalls sogar Destruktives. Man hat Hannah Arendt daher einmal, in halbem Ernst, als erste »Neokonservative« avant la lettre bezeichnet, aber das ist ein anderes Thema.
Ich komme zum Schluss. Wir haben Hannah Arendt hierzulande im Licht des Umbruchs von 1989 für uns wieder entdeckt. Und sind vielleicht dabei, sie mit der allmählichen Einebnung dieser zeitgeschichtlichen Zäsur schon wieder zu verlieren. Haben wir diese Autorin heute, im Licht des 11. September 2001, noch einmal wieder zu entdecken, wie manche amerikanische Interpreten ihrer Werke zu meinen scheinen? Es könnte ein schwer verdaulicher Brocken für uns werden. Denn eine Hannah Arendt mit ihrer Bereitschaft, sich der Gewalt von »Ideologie und Terror« in ihrer Zeit gedanklich zu stellen; mit ihrem idealistischen, nicht selten etwas pathetisch anmutenden Votum für die Freiheit, lässt sich kaum als ein Fall von amerikanischem Wahnwitz abheften.
Ich kann Hannah Arendt schlecht lesen, ohne mich zu fragen, wo ich selbst stehe. So könnte ich mich heute etwa fragen, ob ich bereit bin, den Totalitarismus islamistischer Provenienz überhaupt als eine neue Form von Totalitarismus wahrzunehmen oder anzuerkennen. Oder ob ich es nicht doch vorziehe, ihn nach lieber alter Gewohnheit als einen brutalen, aber verständlichen Protest der »Dritten Welt« gegen uns und unsere egoistisch behauptete Vormacht auf der Welt zu verharmlosen. Oder ich könnte mich fragen, wie wichtig mir denn die politische Freiheit in der Welt ist, sagen wir, im Nahen Osten – mir als Europäer, wenn ich den Amerikanern schon so misstraue. Vielleicht müsste ich mir ja eingestehen, dass die Freiheit der Menschen, der anderen, für mich an Bedeutung hinter der Stabilität der Regimes zurücksteht, seien sie noch so freiheitsfeindlich. In diesem Fall sollte ich freilich Hannah Arendt besser aus der Hand legen.
Der Vortrag erschien zuerst in Kommune. Forum für Politik, Ökonomie und Kultur, Heft 03/2005 [Webarchiv].
Fußnoten
- »Die Ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus«, 1958, jetzt in: Hannah Arendt: In der Gegenwart, hrsg. von Ursula Ludz, München 2000.
- Hier zitiert nach: Hannah Arendt, In der Gegenwart, a. a. O.; der Titel des Textes lautet jetzt: »Die Nachwirkungen des Naziregimes: Bericht aus Deutschland«.
- Hannah Arendt/Heinrich Blücher: Briefe 1936–1968. Hrsg. von Lotte Köhler, München 1999.
- Hier zitiert nach: Hannah Arendt, In der Gegenwart, a. a. O.
- »Befehl und Gehorsam«, in: Hans Buchheim, Martin Broszat, Hans-Adolf-Jacobsen, Helmut Krausnick: Anatomie des SS-Staates, 6. Aufl. 1994, dtv.
- 1963, hier zitiert nach der deutschen Ausgabe von 1965.
- »Was heißt persönliche Verantwortung unter einer Diktatur?«, 1964, jetzt in: Hannah Arendt: Nach Auschwitz. Hrsg. von Eike Geisel und Klaus Bittermann, Berlin 1989.
- Vgl. Hannah Arendt: Was ist Politik? Aus dem Nachlass. Hrsg. von Ursula Ludz, München 1993.
- »Über den Zusammenhang von Denken und Moral«, 1971, jetzt in: Hannah Arendt: Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Hrsg. von Ursula Ludz, München 2000.
- Vgl. Roy T. Tsao, in: Antonia Grunenberg, Hrsg.: Totalitäre Herrschaft und republikanische Demokratie, Frankfurt/M. 2003.
- Ulrich Herbert: Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft 1903–1989, Bonn 1996.
- Ebenda.
- Wieder gedruckt in: Hannah Arendt: Zwischen Vergangenheit und Zukunft, a. a. O.
- Hannah Arendt: Vom Leben des Geistes. Bd.1. Hrsg. von Mary McCarthy, dt. Ausgabe München 1979.
- »Gestern waren sie noch Kommunisten«, 1953, jetzt in: Hannah Arendt: In der Gegenwart, a. a. O.
- Hannah Arendt: Vor dem Antisemitismus ist man nur auf dem Monde sicher. Hrsg. von Marie Luise Knott, München 2000.
- »… in keinem Besitz verwurzelt«. Hrsg. von Ingeborg Nordmann und Iris Pilling, Hamburg 1995.
- »Gedanken zu Lessing: Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten«, 1959, jetzt in: Hannah Arendt: Menschen in finsteren Zeiten. Hrsg. von Ursula Ludz, München 2001.
- Vgl. Daniel Ganzfried u. Sebastian Heft, Hrsg.: Hannah Arendt. Nach dem Totalitarismus, Hamburg 1997.
- Erster Band, 1835, hier zitiert nach: Reclam-Auswahl, hrsg. von J. P. Mayer, Stuttgart 1997.
- »Die Lüge in der Politik«, jetzt in: Hannah Arendt: In der Gegenwart, a. a. O.